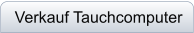Luftwege
Luft - ist Leben
Die Atmungsorgane versorgen unseren Körper mit lebensnotwendigem Sauerstoff, der aus der Luft in den
Blutkreislauf aufgenommen werden muß. Zu diesem Zweck wird unsere Atemluft in ein feines Röhrensystem
mit unzähligen, baumähnlichen Verästelungen - die Bronchien - geleitet, um von dort weiter an etwa 500
Millionen Lungenbläschen mit einer Gesamtfläche von nahezu 100 m² abgegeben zu werden. Diese
Lungenbläschen sorgen dafür, daß das Blut den Sauerstoff aus der Luft aufnehmen und so alle Bereiche
unseres Körpers versorgen kann.
Atmung - eine "saubere" Sache
WFür einen optimalen Sauerstoff-Austausch ist es überaus wichtig, daß die Funktion der Bronchien nicht
durch Fremdkörper, wie z.B. Staubpartikel, behindert wird. Deshalb besitzen unsere Atemwege einen
hervorragenden natürlichen Reinigungsmechanismus: Sie sind mit einer Schleimhaut sowie einer Vielzahl
von Flimmerhärchen ausgestattet. Diese sorgen dafür, daß die mit der Atemluft eindringenden Partikel
automatisch wieder nach außen befördert werden. Zahlreiche Schleimdrüsen unterstützen die
Flimmerhärchen bei dieser Aufgabe, indem sie das gesamte Atemsystem ständig befeuchten.
Die normalen Lebensvorgänge im menschlichen Körper (Physiologie) sind beim Tauchen anderen
Auswirkungen als auf dem Land ausgesetzt. Betroffen sind vor allem die Organe, die die
Sauerstoffversorgung des Organismus gewährleisten, d.h. die Atmungsorgane und das Herz-Kreislaufsystem.
Von den veränderten Druckverhältnissen sind beim Tauchen alle luftgefüllten Hohlräume des Körpers
betroffen.
Aufgabe der Atmung:
Alle Körperzellen mit dem lebensnotwendigen Sauerstoff (O 2 ) der Luft zu versorgen und das bei den
Stoffwechselvorgängen entstehende Kohlendioxyd (CO2 ) zu entfernen
Die Atmungsorgane bestehen aus dem Nasen-Rachen-Raum, dem Kehlkopf mit der Stimmritze, der
Luftröhre, den Bronchien und dem eigentlichen Lungengewebe mit den elastischen Fasern und den
Lungenbläschen (Alveolen).
Die Atmungsluft kann durch Nase und Mund in der o.g. Reihenfolge zu den Alveolen gelangen. In den
Atemwegen findet noch kein Gasaustausch statt, deshalb bezeichnet man sie auch als Totraum.
Der Gebrauch eines überlangen Schnorchels vergrößert den Totraum in gefährlicher Weise: Es tritt
Pendelatmung auf mit CO2 Vergiftung und Sauerstoffmangel. Außerdem entsteht ein relativer Unterdruck
in den Lungen, der sich schädigend auswirkt. Darum:
Nie überlange Schnorchel verwenden !!!
Filtration, Befeuchtung und Erwärmung der Atemluft
Im vordersten Teil der Nasenhöhle halten die Nasenhaare wie ein Sieb die gröberen Verunreinigungen
zurück. Das Naseninnere ist mit einer mit Flimmerhärchen besetzten Schleimhaut (Flimmerepithel)
überzogen. Durch eine große Anzahl von Schleimdrüsen wird das Naseninnere ständig feucht gehalten.
Dabei verdunstet täglich eine große Tasse Wasser! Bei der Einatmung wird die vorbeistreichende Luft somit
angefeuchtet und erwärmt. Zugleich erfolgt auch eine Feinreinigung der Luft von mitgeführten
Staubpartikeln, die sich auf der Schleimhaut niederschlagen.
Im oberen Teil der Luftröhre liegt der Kehlkopf. Er dient der Stimmerzeugung und vermag durch Verschluß
der Stimmritze (Stimmritzenkrampf) den Luftweg abzusperren. Dieses Phänomen ist eine gefährliche
Unfallursache beim Tauchen, da der Stimmritzenkrampf zu einem Lungenüberdruckbarotrauma mit
Lungenriß führen kann.
Oberhalb des Kehlkopfes mit der Stimmritze schließen die oberen Luftwege an: Der Nasenraum, die
Mundhöhle und der Rachenraum. Eine Erkältung der oberen Luftwege kann eine Schwellung der
Nasenschleimhäute nach sich ziehen. In diesem Fall droht ein Barotrauma, wenn durch die Schwellung kein
oder nur ein ungenügender Druckausgleich möglich ist. Bei einer Erkältung der oberen Luftwege sollte
daher auf das Tauchen verzichtet werden.
Unterhalb des Kehlkopfs schließen sich die unteren Luftwege an. Sie bestehen aus der Luftröhre, dem
rechten und dem linken Stammbronchus und den bis in die Alveolen verzweigenden Bronchialästen. Durch
die gesamten Luftwege wird die Atemluft in die Alveolen gesogen, wo der Gasaustausch stattfindet.
Zusammengefaßt heißt das:
Die Atemluft passiert die Atemwege: Hals-, Nasen-Rachenraum, Luftröhre, Bronchien, Bronchiolen und
gelangt in die Lungenbläschen (Alveolen).
Im ersten Teil der Atemwege wird die Luft von staubförmigen Verunreinigungen gesäubert, angefeuchtet
und auf Körpertemperatur erwärmt.
Erst in den Alveolen, die von feinen Haargefäßen (Kapillaren) umgeben sind, geschieht der eigentliche
Gasaustausch.
Nun gelangt von der Luftröhre die Luft in die zwei Hauptäste der Bronchien, die die Luft der Lunge
zuführen.
In der Luftröhre und den Bronchien sollen die letzten feinsten Staubteilchen, die noch in der Atemluft
enthalten sind, entfernt werden. Sie sind deshalb in ihrem Inneren auch mit schleimabsondernden Zellen
ausgekleidet. Zwischen diesen befinden sich andere Zellen, die mit zahlreichen Flimmerhärchen besetzt sind.
Die Härchen sind in ständiger rhythmischer Bewegung und schlagen immer nach der gleichen Richtung. Auf
diese Weise wird der ausgeschiedene Schleim mit den eingefüllten winzigen Staubteilchen nach außen
befördert und kann so ausgeschieden werden. Die Luft gelangt dann in die Lungenbläschen (Alveolen), in
diesen findet dann der Gasaustausch statt.
Die Atmung wird auch äußerer Gasaustausch genannt.
Atemtechnik
Die Ventilation (Luftwechsel) ist notwendig, um die Luft in den Lungen zu erneuern. Sie kommt durch
rhythmisch abwechselnde Ein- und ausatmung zustande. Hierbei sind der Brustkorb, die
Zwischenrippenmuskulatur, Zwerchfell und die Lunge selbst beteiligt. Der Brustkorb ist elastisch und tritt
immer wieder in die Ausgangslage zurück - Atemruhelage.
Einatmung
ist ein aktiver Vorgang und von Muskelarbeit abhängig. Die Oberfläche der Lunge mit ihrem Lungenfell
(Pleura) haftet an der Innenseite des Brustkorbes mit seinem Rippenfell. Dazwischen befindet sich ein
flüssigkeitsgefüllter Spalt. Durch Hebung und der damit verbundenen Erweiterung des Brustkorbs entsteht
in dem Flüssigkeitsspalt der Pleurablätter ein Unterdruck. Das Lungengewebe folgt diesem Sog, d.h. die
Lungenbläschen erweitern sich. Damit wird Luft über das Bronchialsystem angesaugt und die einströmende
Luft gleicht den Unterdruck wieder aus.
Ausatmung
ist ein passiver Vorgang. Die Zwischenrippenmuskulatur erschlafft, der Brustkorb geht in die Atemruhelage
zurück. Die damit verbundene Volumenverringerung bewirkt ein Ausströmen der Luft über die Atemwege.
Atmung und Atemregulation
Die Atmung ermöglicht die Sauerstoffaufnahme und die Sauerstoffabgabe in den Alveolen.
Sauerstoff ist das für die Verbrennung im Organismus notwendige Gas. Es dient der Energiegewinnung.
Stickstoff (N2) ist unter normalem Umgebungsdruck ein geruchloses und unschädliches Füllgas (Inertgas),
das offenbar nicht am Stoffwechsel teilnimmt. Kohlendioxid ist das Oxidationsprodukt, das als
Stoffwechselprodukt bei der Energiegewinnung entsteht und beim Ausatmen an die Umgebung abgegeben
wird. Tritt CO2 in höherer Konzentration als 0,035% im Atemgas auf, kann es zu
Vergiftungserscheinigungen kommen. Kohlenmonoxid (CO) darf in der Atemluft nicht vorhanden sein.
Edelgase zeigen ein chemisch inaktives Verhalten und sind an der Atmung nicht beteiligt.
Zusammensetzung der Luft bei:
Einatmung
Ausatmung
21 %
Sauerstoff (O2)
17 %
0,03 % Kohlendioxyd (CO2)
4,03 %
78 %
Stickstoff (N2)
78 %
0,97 % Edelgase
0,97 %
Schlucken, Nasenatmung und Mundatmung
Schlucken
Beim Schlucken wird das Gaumensegel (oder Zäpfchen) gehoben, der Eingang der Luftröhre durch den
Kehldeckel verschlossen. Somit können keine Speiseteile in die Luftwege gelangen.
Nasenatmung
Wenn wir normal durch die Nase einatmen, wird das Gaumensegel gesenkt und der Kehldeckel gehoben, so
daß die Atemluft ungehindert vom Nasen-Rachen-Raum durch die Luftröhre in die Lunge strömen kann.
Mundatmung
Beim Tauchen erhalten wir unsere Atemluft vom Lungenautomaten via Mund zugeführt. Normalerweise ist
dabei das Gaumensegel gehoben, der Kehldeckel selbstverständlich auch.
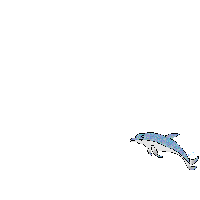
Copyright © 2000-2026 Tauchsportcenter Easy Diving, Mainzer Strasse 119, 65189 Wiesbaden, Tel. 0611-713507

33 Jahre Tauchen 33 Jahre Ausbildung 33 Jahre Reisen